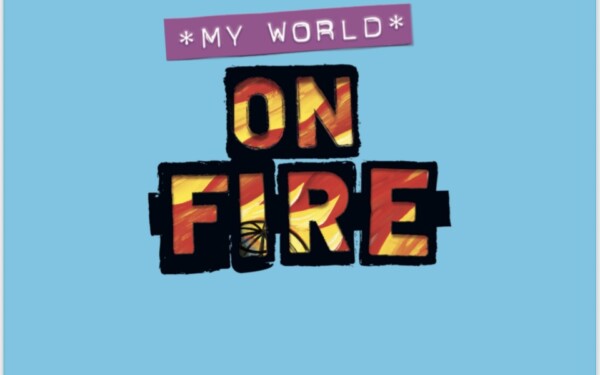CHRISTY ASTUY
Santissima
In den Gemälden von Christy Astuy verschmelzen europäische und amerikanische Bildwelten zu einer privaten Ikonographie, die mit zahlreichen Zitaten und Anspielungen nicht nur eine bemerkenswerte Fülle an kunsthistorischen Assoziationsmöglichkeiten bietet, sondern auch das Verhältnis von Form und Inhalt auf höchst unorthodoxe Weise zu hinterfragen wagt.
Will man sich als neugieriger Betrachter nicht ausschließlich auf den Genuss des „schönen Scheins“ der attraktiven Geschichten zurückziehen, die einem hier in vorzüglicher Technik und delikater Farbigkeit erzählt werden, so sind mehrere Wege geeignet, um tiefer in den Astuy´schen Kosmos vorzudringen.
Nach langjährigen, intensiven Studien hat sich ihr offensichtliches Interesse für die alten Meister nicht nur in technischen, unmittelbar das malerische Handwerk betreffenden Kenntnissen niedergeschlagen. Die Künstlerin eröffnete sich damit zugleich ein schier unerschöpfliches Reservoir an Motiven, das sie zur Entwicklung ihres unverwechselbaren Personalstils zu nutzen wusste.
Für die „Amerikanerin“ Astuy stellen die Meisterwerke der abendländischen Kunstgeschichte einen formalen Fundus dar, mit dem sie in gewisser Hinsicht freier und unbefangener verfahren kann als ihre im Abendland geborene und sozialisierte Kollegenschaft. Das europäische Kunst-Füllhorn wird von ihr geplündert und zwar ohne Skrupel gegenüber dem verinnerlichten „Ballast“ an historischen Bezügen und Nebenbedeutungen, den unsere Jahrhunderte alte Gesellschaft gewohnt ist, als gemeinsamen kulturellen Standard in allen Äußerungen (mehr oder weniger bewusst) mitzudenken bzw. zu berücksichtigen. Frei von traditionellen Bindungen dieser Art bevorzugt Christy Astuy ein hierarchieloses System und entwickelt die Erzählstränge ihrer exotisch anmutenden Szenarien auch aus „Unpassendem“ heraus.
Dort, wo Barbie und die Mutter Gottes in Begleitung von Picasso-Figuren aufeinander treffen, entsteht durch die Diskrepanz der Protagonisten eine spezifische Komik, die zugleich seltsame Sinnzusammenhänge produziert.
Schönheit, Liebe, persönliche Vorlieben und Gegenstände, für die sich die Künstlerin seit ihren Jungmädchenjahren begeistert, werden aus ihrer subjektiven weiblichen Sicht behandelt. Ohne feministische Attitüde und jenseits politischer Korrektheit entsprechen die gewählten Themen, wie auch die malerische Ausführung dennoch auf höchst raffinierte Weise dem, was von der zeitgenössischen Kunsttheorie an intellektueller Arbeit im Sinne einer Selbstreflexion des Mediums Malerei gefordert wird.
Das Collageprinzip wird dabei in mehrfacher Hinsicht zur bestimmenden Methode ihrer künstlerischen Praxis. Als Möglichkeit, Motivfragmente verschiedener Herkunft zusammenzusetzen und das Bild in seiner Gesamtheit zu strukturieren, bietet sich damit auch ein Modus an, um unterschiedliche Inhalte und Realitätsebenen der Erzählung kaleidoskopisch miteinander zu verknüpfen.
Von jedweder Zeitlichkeit gelöst oszillieren in ihren Arbeiten nicht nur stilistische Elemente aus schrillem Pop, italienischer Trecento- bzw. Quatrocentomalerei, Impressionismus, Kubismus, Neuer Sachlichkeit, etc., sondern die Kategorien des „genus humile“ mischen sich gleichzeitig mit jenen des „genus sublime“ zu einer sehr persönlichen Form von demokratischer Weltsicht, um mit diesen oftmals bizarr erscheinenden Zusammenführungen letztlich Ikonen einer visuellen Fusion der Bildtraditionen zweier Kontinente zu kreieren.
Santissima versammelt nun Arbeiten, vor allem aus jüngster Zeit, die sich auf Astuys spezifische Weise dem religiösen Sujet annähern.
Andrea Jünger
Christy Astuy Lebenslauf
geboren 1956 in Carmel, CA/USA, lebt und arbeitet die Künstlerin seit 1980 in Wien. Sie studierte ab 1981 an der Hochschule (jetzt Universität) für Angewandte Kunst Wien (bis 1984) und an der Akademie der bildenden Künste Wien (bis 1988). Von 1993 bis 1997 war sie Assistentin von Prof. Mario Terzic/Meisterklasse für Grafik an der Universität für Angewandte Kunst Wien. 1995 erhielt sie ein Auslandsstipendium in Paris und 2000 eines in Rom. Sie lebt und arbeitet in Wien und Italien
Seit 1988 erfolgen Einzelausstellungen und Beteiligungen u.a. in: Wien (Galerie Jünger, Galerie Gerersdorfer, Kunsthandlung Gril, Galerie Elisabeth Michitsch, Bank Austria Kunstforum, MUSA, Kunsthistorisches Museum), Salzburg (Galerie Thaddaeus Ropac, Galerie Altnöder), Baden bei Wien (Galerie Jünger, Galerie Menotti), Mürzzuschlag (Kunsthaus Mürz), Krems (Kunsthalle), Graz, Innsbruck (Galerie Thoman, Galerie Thomas Flora), sowie in Split/HR, Tel Aviv/IL, Prag/CZ, Rom/I und Siegen/D.
Ihre Werke befinden sich u.a. in den Sammlungen der Artothek des Bundes, des Leopold Museums, der Österreichischen Galerie im Belvedere, der Universität für Angewandte Kunst, dem Rupertinum in Salzburg und des MUSA (Kunstsammlung der Stadt Wien), sowie in zahlreichen privaten Sammlungen. Ihre seit 1988 publizierten Werkkataloge enthalten Texte u.a. von Friedericke Mayröcker, Otmar Rychlik, Burghart Schmidt, Ulrich Gansert und Franz Graf, ihre Ausstellungen wurden u.a. von Kristian Sotriffer, Claudia Aigner, Markus Mittringer, Otmar Rychlik und Judith Fischer besprochen.
Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag: 10 – 18 Uhr, Sonntag: 10 – 16 Uhr
Dauer der Ausstellung: 23.11.2025 – 15.02.2026